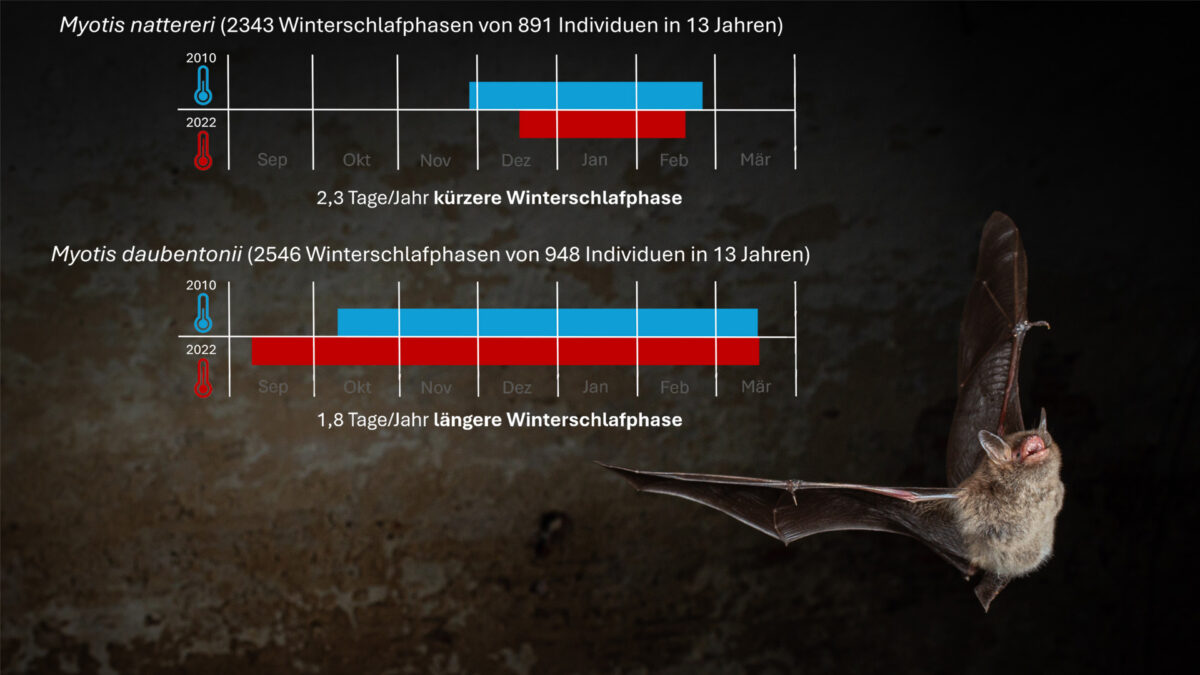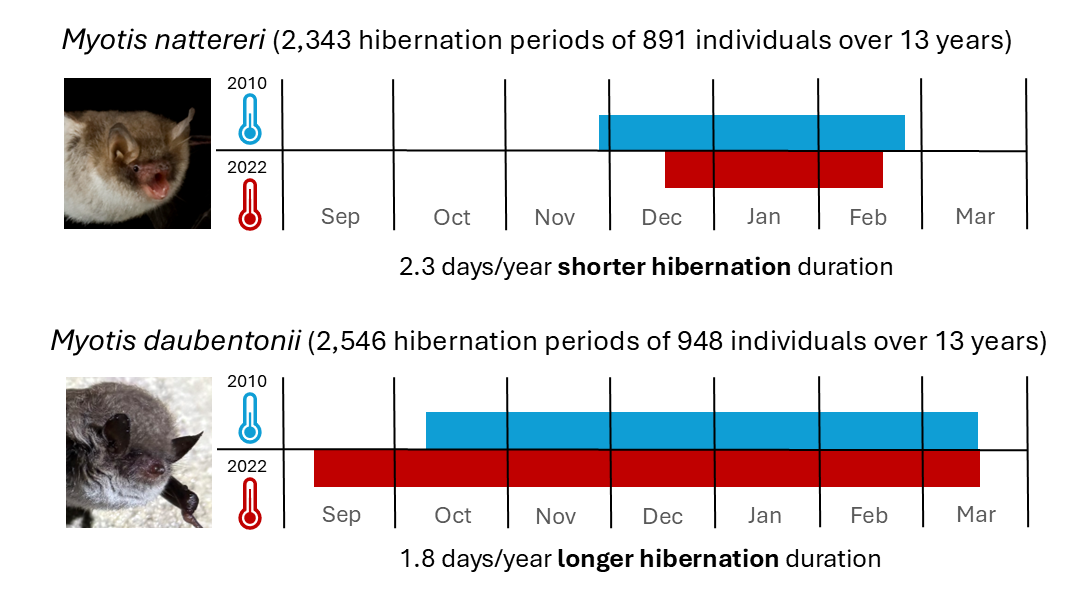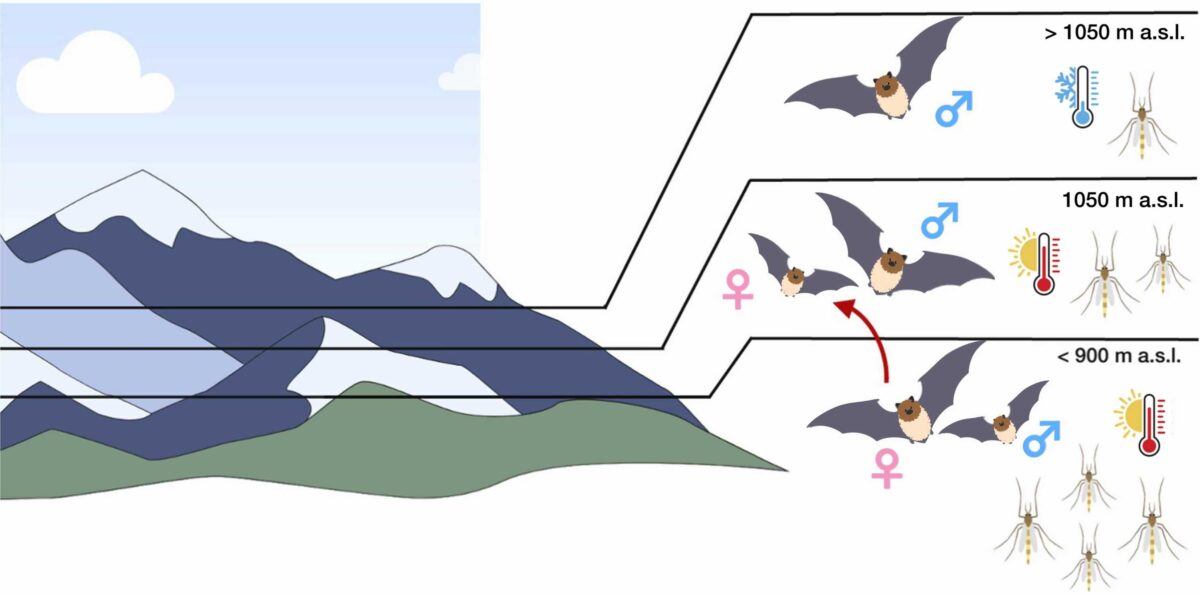Turkestan-Langohr wiederentdeckt
Einem internationalen Forscherteam aus Deutschland, Usbekistan und Turkmenistan unter Federführung des Museums für Naturkunde Berlin gelang der Wiederfund einer seit 55 Jahren verschollenen Fledermausart, von der erstmals Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden konnten. Ziel ist nun die umfassende Erforschung der evolutionären Entwicklung der zentralasiatischen Fledermausfauna. Den Wiederfund des Turkestan-Langohrs nimmt die turkmenische Regierung zum Anlass, ein großes Schutzgebiet zu planen, von dem viele weitere Tier- und Pflanzenarten profitieren.

Erstmals lebend fotografiert: Ein seit Jahrzehnten verschollenes Turkestan-Langohr Plecotus turkmenicus bei seiner Wiederentdeckung. Foto: Christian Dietz.
Das nur aus wenigen Sammlungsbelegen in russischen Museen bekannte Turkestan-Langohr (Plecotus turkmenicus) wurde zuletzt 1970 beobachtet.
Fotos oder eine verlässliche Beschreibung lebender Tiere gab es bisher nicht. Im Zuge der systematischen Überprüfung der turkmenischen Fledermausfauna zur Aktualisierung der Roten Liste erhielt die Art aufgrund des geringen Kenntnisstandes höchste Priorität. Als endemische Art der Karakum-Wüste in den Grenzregionen von Turkmenistan, Kasachstan und Usbekistan bestand die Sorge, dass sie sehr selten oder gar ausgestorben ist.
Im Oktober dieses Jahres wurde die Fledermaus daher zum Ziel einer internationalen Forschungsexpedition. Dabei wurden die historischen Fundpunkte und andere geeignete Stellen in der Karakum-Wüste aufgesucht. Zunächst wurde ein junges Weibchen des Turkestan-Langohrs in einer Abrisskluft gefunden. An einer 87 Kilometer entfernten Lößhöhle im Grenzgebiet zu Usbekistan wurde noch ein erwachsenes Männchen gesichtet. Nach Jahrzehnten wurde so die Existenz der Art bestätigt. Erstmals konnten Ton-, Bild- und Videomaterial dieser Wüstenfledermaus erstellt und Proben für genetische Untersuchungen gesammelt werden. Ziel ist die umfassende Erforschung der evolutionären Entwicklung der zentralasiatischen Fledermausfauna.

Turkestan-Langohr Plecotus turkmenicus. Foto: Christian Dietz.
Das Turkestan-Langohr dürfte insbesondere durch den Klimawandel gefährdet sein. Durch die vor allem temperaturbedingt fortschreitende Austrocknung der Wüsten Zentralasiens geht die natürliche Vegetationsbedeckung immer weiter zurück und der ohnehin schon begrenzte Lebensraum der Art verringert sich weiter. Den Wiederfund des Turkestan-Langohrs nimmt die turkmenische Regierung nun in ihre Planung für die Ausweisung eines über 50.000 Hektar großen Schutzgebietes auf. Hiervon würde neben der endemischen Fledermausart auch die gesamte Artenvielfalt der winterkalten Wüsten bis hin zu großen Säugetieren wie Wildesel und Kropfgazelle profitieren.
Der grenznahe Nachweis könnte außerdem ein Hinweis auf ein bisher unentdecktes Vorkommen des Turkestan-Langohrs in Usbekistan sein. Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Museum für Naturkunde Berlin, dem turkmenischen Umweltministerium, der turkmenischen Schutzgebietsverwaltung und der usbekischen Akademie der Wissenschaften zur Erforschung der zentralasiatischen Fledermausfauna soll fortgesetzt werden.
Foto: Christian Dietz