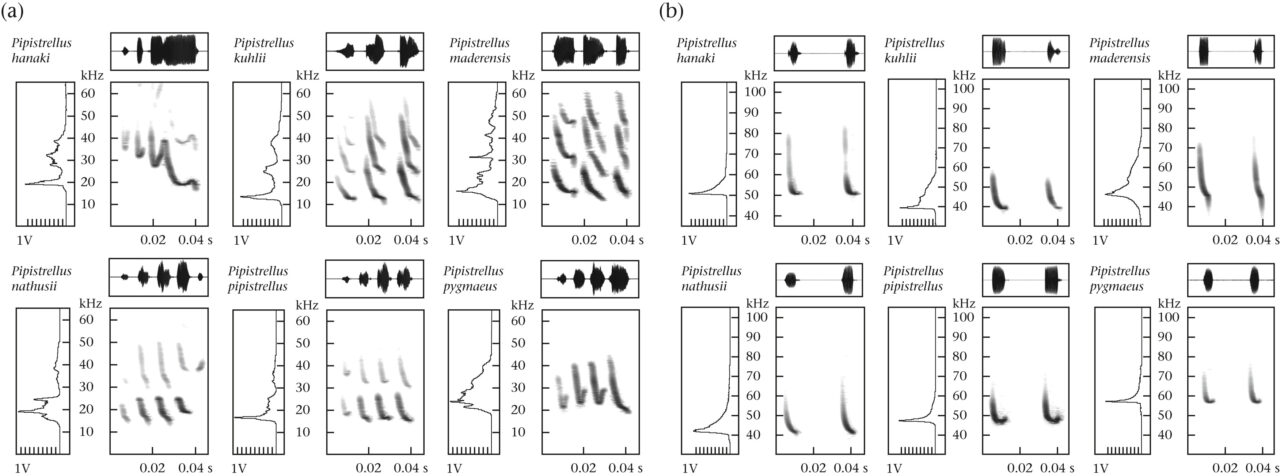Phänomen einer Überwinterungsstrategie
Weit verbreitet ist die Annahme, dass die Wochenstuben- und Sommerquartiere auch gleichzeitig Winterquartiere von Zwerg- und Mückenfledermäusen sind. Diese Annahme legt nahe, dass andere Gebäude als Winterquartiere weniger in Frage kommen. Ist das so?
Was wir wissen
Mindestens zwei Methoden der Überwinterung von Zwerg und Mückenfledermäusen sind bekannt:
- Einzelne Tiere oder kleine, verteilte Gruppen
- große Gruppen in Massen-Winterquartieren
Unsere mitteleuropäischen Winter sind oft mild, mit leichten Nachtfrösten und ab und zu mäßigen Frostperioden. Setzt starker Frost ein, wandern Zwergfledermäuse in die Massenwinterquartiere. Woher die Tiere kommen, wissen wir meist nicht, vermutlich aber aus der näheren oder weiteren Umgebung. Es sind möglicherweise Zwerg- und Mückenfledermäuse, die das Quartier wechseln, weil das ursprüngliche nicht frostfrei oder sogar zu warm ist. Zwergfledermäuse wechseln also als Teil ihrer Überwinterungsstrategie das Quartier (Sendor, 2002, Simon et al. 2004).
Bekannt sind auch Winterfunde einzelner Tiere oder kleinerer Gruppen von Zwergfledermäusen in Kästen, die hauptsächlich im Frühjahr und Herbst als Quartier genutzt werden. Die Tiere verlassen die Kästen bei Frost, kehren aber oft nach der Frostperiode zurück. Es wird vermutet, dass es sich dabei um Männchen handelt, die den Paarungsritus möglichst lange aufrechterhalten wollen. Auch sind Funde in und an Gebäuden und unterirdischen Quartieren bekannt. Wenig bekannt ist, wie die Tiere dort auf Frost- oder Wärmeperioden reagieren.
Die Problematik
Als Massenwinterquartiere kommen Gebäude jeder Größe, jeden Alters und jeder Bauart in Frage, ebenso Ruinen, Brücken und ähnliche Bauwerke, Felsquartiere und unterirdische Quartiere. Diese sind meist schwer zugänglich, schlecht einsehbar und daher kaum zu kontrollieren.
Es gibt kaum Methoden, durch die mit vertretbarem Aufwand Winterquartiere einzelner oder Massen von Zwergfledermäusen mit hoher Sicherheit nachgewiesen oder ausgeschlossen werden können.
Ohne die Möglichkeit einer Untersuchung besteht die Gefahr, dass Massenwinterquartiere zerstört und lokale oder sogar überregionale Populationen der Zwerg- und Mückenfledermaus vernichtet werden. Oft werden Gebäude in den Wintermonaten abgerissen oder saniert, ohne dass eine mögliche Nutzung als Winterquartier berücksichtigt wird.
Mit einer Kombination von Methoden können große Überwinterungsquartiere von Zwergfledermäusen in modernen, mehrstöckigen Gebäuden und Hochhäusern im städtischen Bereich entdeckt werden. Vielfach sind es Gebäude, die bei oberflächlicher Betrachtung als mögliche Quartiere übersehen oder gleich ausgeschlossen werden.
Wirklich keine Methode?
Die niederländischen Kollegen um Erik Korsten, Eric Jansen, Herman Limpens und Martijn Boonman (2016) beschreiben im Artikel „Swarm and switch: on the trail of the hibernating common pipistrelle“ ein bislang wenig bekanntes winterliches Schwarmverhalten von Zwergfledermäusen, das bei einzelnen Tieren, aber auch in Massen an Gebäuden auftritt. Weiter wird das spätsommerliche Schwärmen um Mitternacht als Indikator für mögliche Winterquartiere benannt.
Methode 1:
Spätsommerliches Schwärmen
Zeitpunkt: Anfang August bis Mitte September mit einem Höhepunkt von Mitte bis Ende August. Begehung ab Mitternacht für zwei Stunden, besser zwei Stunden nach Sonnenuntergang bis zwei Stunden vor Sonnenaufgang.
Wetter: möglichst windstille, warme Nächte mit Temperaturen ab 15° C gegen Mitternacht.
Technik: Einfacher Detektor, starke Taschenlampe (Hochhaus), Fernglas, zu Fuß oder per Fahrrad.
Wiederholen: alle paar (fünf bis zehn) Nächte bei optimalem Wetter die Begehung wiederholen.
Methode 2:
Frostschwarmverhalten im Winter
Warten Sie bis zur ersten Frostperiode und suchen in den folgenden zwei, drei und vier Nächten dieser Frostperiode nach schwärmenden Tieren. Die Nächte sollten kalt, mit Temperaturen deutlich unter null sein. Beginnen Sie etwa 45 Minuten nach Sonnenuntergang und für die Dauer von etwa zwei bis drei Stunden.
Die Suche im Winter kann auf das Finden der Schwarmquartiere im August aufbauen. Dies schränkt die Suche auf bestimmte Gebäude und Bereiche der jeweiligen Gebäude deutlich ein. Man kann diese Methode aber auch „auf gut Glück“ bei zum Beispiel ehrenamtlicher, systematischer Suche anwenden, ohne im Spätsommer nach Quartieren gesucht zu haben.
Aber Achtung! Kein Nachweis bedeutet nicht automatisch, dass den ganzen Winter keine Fledermäuse anwesend sind!
Es stellen sich Fragen
- Schwärmen Zwergfledermäuse auch in den wärmeren Nächten nach einer Frostperiode?
- Lässt sich das Verhalten auch auf Quartiere in/an Felsen z. B. im Mittelgebirge übertragen?
- Wie sieht es mit (kleineren) Überwinterungsgruppen an niedrigeren Gebäuden aus?
- Ist das Frostschwärmen auch bei anderen Arten wie Breitflügelfledermaus, Nordfledermaus oder Zweifarbfledermaus zu beobachten?
Bitte helfen Sie mit
Um Fragen zu klären und vor allem um diese oft übersehenen Quartiere und Fledermäuse zu schützen, sind Sie als Gutachter aufgerufen, dieses Wissen anzuwenden und als Ehrenamtler auch im Winter etwas Zeit zu investieren.
Ganz Wichtig! Melden Sie diese Winterquartiere unbedingt den zuständigen Behörden!
Es wäre schön, wenn Sie Ihre Entdeckungen mit uns und anderen teilen. Dazu sammeln wir möglichst viele Informationen auf dieser Webseite.
Das Video von Erik Korsten (Zoogdiervereniging, NL) von Ende Dezember 2014 zeigt viele schwärmende Zwergfledermäuse bei Schnee und -5°C.
Ohne diese Kenntnisse besteht die Gefahr, dass Massenwinterquartiere zerstört und lokale oder sogar überregionale Populationen der Zwergfledermaus vernichtet werden. Wir wissen, dass diese Gebäudetypen oft abgerissen oder renoviert werden, ohne dass es eine Fledermausuntersuchung mit dem Ziel schwärmende Fledermäuse oder Winterquartiere zu finden, gibt.
Es ist daher wichtig, dass Gutachter die richtigen Untersuchungsmethoden anwenden, um überwinternde Zwergfledermäuse nachzuweisen. Besser wäre es flächendeckende Kartierungen durchzuführen, um diese sehr wichtigen, aber auch sehr anfälligen Quartiere nicht nur den Behörden bekannt zu machen.
Rückmeldung:
Interessant wäre mal eine Rückmeldung ob ihr erfolgreich wart und was ihr beobachten konntet.
Einfach per Mail an Christian Giese: giese@fledermausschutz.de
- Ingolstadt: ca. 20 schwärmende Mückenfledermäuse im Dezember an einem einstöckigen Mehrfamilienhaus bei Frost.
- Süd-Pfalz (2019): 40-50 schwärmende Mückenfledermäuse bei Frost
- Süd-Pfalz (2019): wenige schwärmende Mückenfledermäuse bei Frost an großer (1.000) Wochenstube
- Rhede, NRW (2019): einzelne schwärmende Zwergfledermäuse bei Frost (Grundschule, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus )
–-
Downloads:
(Massa-)winterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen: discussiestuk Vleermuisprotocol 2017
von Erik Korsten (Bureau Waardenburg), Herman Bouman (Arcadis) & Daniel Tuitert (Sweco)
Swarm and switch: on the trail of the hibernating common pipistrelle (2016)
Quelle: Bat News. No. 110 (Summer 2016). p. 8-10. Bat Conservation Trust. London.
Korsten, Erik & Jansen, Eric & Limpens, Herman & Boonman, Martijn & Schillemans, Marcel. (2016).
Swarm and switch: on the trail of the hibernating common pipistrelle.
Nyctalus (N.F.), Berlin 7 ( 1999), Heft I, S. 1 02 – 111
Die Ansprüche der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) an ihr Winterquartier
Von MATIHIAS SIMON, Marburg, und KARL KUGELSCHAFTER, Gießen
Christian Giese
für den LFA Fledermausschutz NRW
Das Video von Erik Korsten (Zoogdiervereniging, NL) vom 18. Januar 2016 zeigt schwärmende Zwergfledermäuse bei -3°C. Erik hat an dem Abend an mehren Gebäuden schwärmende Zwergfledermäuse gefunden.
Video von Erik Korsten (Zoogdiervereniging, NL) vom 19. Januar 2019 in Tilburg Noord (NL).